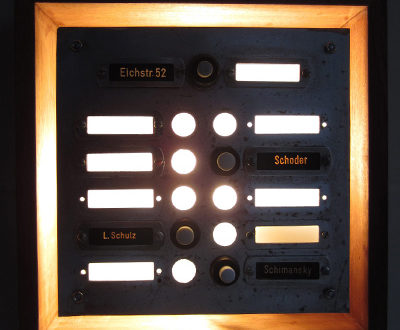Die hohe Kunst der Benötigung
Der Fünfjährige schiebt sich den dritten Apfelpfannkuchen in den Mund. Und schielt gleichzeitig nach den belegten Broten, die eigentlich für die Erwachsenen gedacht sind. Die Siebenjährige begräbt ihren Teller währenddessen unter einem Berg Zimtzucker. Die Erwachsenen sind mit Quatschen beschäftigt, also hält sie niemand davon ab. Zum Glück sind wir ein paar Tage bei Friedolins Großeltern zu Gast. Bei dem, was unsere Kinder gerade essen, hätten wir sonst längst einen Kredit aufnehmen müssen. Eigentlich wollten wir Tagesausflüge in Dithmarschen unternehmen. Aber wir kommen vor lauter Mahlzeiten nicht dazu.
„Nordseeluft und Wellen machen Kinder hungrig, das sagen alle Legenden“, sagt die Siebenjährige mit erhobenem Zeigefinger und vollem Mund.
„Trotzdem ist jetzt mal gut“, sage ich und nehme ihr den Zuckerstreuer aus der Hand. Die Uroma schlägt freudig die Hände zusammen.
„Das hat man ja ganz selten, das Kinder so wunderbar essen“, sagt sie und schiebt beiläufig noch ein doppeltes Salamibrot auf den Teller des Fünfjährigen. Seit Tagen spielen die Kinder mit ihr das Spiel: Wer zuerst satt ist, verliert.
Friedolins Großmutter beherrscht die hohe Kunst der Benötigung: nämlich Gästen solange Berge von Essen aufzutischen, bis alle die Hosenknöpfe öffnen und kapitulierend die Hände heben. Doch an unseren Kindern beißt sie sich die Zähne aus. Unsere Kinder geben nicht auf. Sie essen so lange, bis der Kühlschrank und die Vorratskammer und die Gefriertruhe leer sind. Der Fünfjährige ist selig, dass er endlich mal sämtliche Wurstsorten probieren kann, die auf einen guten norddeutschen Abendbrottisch gehören: Teewurst, Leberwurst, Fleischwurst, Salami. Bei seinen Vegetarier-Eltern gibt es das nicht, so eine Gelegenheit bietet sich so schnell nicht wieder. Die Siebenjährige bleibt standhaft bei Pfannkuchen und Käsebrot. Schließlich hatte ihre heiß bewunderte Freundin aus Berlin uns neulich verkündet, dass sie jetzt auch Vegetarierin sei.
„Cool, seit wann denn?“, fragte ich.
Sie dachte nach.
„Seit, äh… Sonntag.“
Da hatte sie mit ihren Eltern bei einem amerikanischen Diner an der Autobahn pausiert, um lecker Rippchen zu essen. Leider parkte genau in dem Moment ein Schweinetransporter gegenüber.
„Als ich die armen Schweine gesehen habe, wollte ich nie wieder Fleisch essen“, sagte sie ernst.
„Und dabei hatte ich die Rippchen schon bestellt“, sagte ihr Vater immer wieder kopfschüttelnd.
Theoretisch weiß jeder, dass Wurst und Fleisch mal gefühlt und geatmet haben. Aber die emotionale Transferleistung zwischen der Wurst auf dem Teller und dem lebendigen Tier herzustellen, fällt selbst Erwachsenen schwer. Fleisch essen ist ja immer ein Akt der bewussten Verdrängung: wir müssen die Produktionsbedingungen ausblenden, um genießen zu können. Nicht umsonst gibt es für Kinder Bärchenwurst und bis zur Unkenntlichkeit Paniertes, das nichts mehr vom Tier erahnen lässt.
Als Kind hatte ich diesen Zusammenhang zwischen Töten und Essen zuerst bei Fisch hergestellt.
Es gibt ein rührendes Foto von meiner Schwester und mir, wie wir für tote Schollen beten, die mein Vater zuvor aus der Nordsee geangelt hatte. Von dem Tag an weigerte ich mich, Fisch zu essen. Zur endgültigen Vegetarierin bin ich jedoch erst viel später geworden. Als ich so viele Artikel über Massentierhaltung und Klimaschutz gelesen hatte, dass ich nicht mehr verdrängen konnte, was die Tiere und unser Planet erleiden mussten, bevor das Fleisch auf meinem Teller landete.
„Du weißt schon, dass du gerade genau so ein Schwein isst, wie du auf dem Bauernhof gestreichelt hast?“, sagt die Siebenjährige zu ihrem kleinen Bruder.
„Na und, das Schwein muss doch sowieso irgendwann sterben und es ist lecker“, sagt er achselzuckend.
So in etwa hatte auch sein Urgroßvater das vorher formuliert. Wir bleiben mit der Rechtfertigung für unseren Fleischkonsum auf dem Niveau von Fünfjährigen stehen.