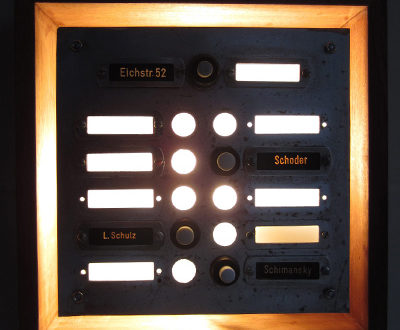Herztonmusik
Ich höre am Schrei, dass der Fünfjährige sich ernsthaft verletzt hat. Es ist kein trotziges Brüllen, kein jämmerliches Klagen oder erschrockenes Weinen, es ist ein Schrei aus purem Schmerz. Sofort wird mir eiskalt und ich schalte in diesen entrückten Automaten-Modus, in dem man sich selbst erstaunt dabei zusieht, wie ruhig man alle wichtigen Handgriffe erledigt, während ein gut verpackter Teil tief in einem verzweifelt schreit und hyperventiliert. Ruhig stehe ich auf, atme tief durch und laufe zu meinem Kind. Der Fünfjährige liegt verdreht auf dem Rasen und wimmert immer wieder: Mama. Der Unterarmknochen ist seltsam verschoben, er ist eindeutig gebrochen. Als ich ihn vorsichtig berühre, schreit er vor Schmerz auf. In diesem Zustand können wir ihn nicht in den Kindersitz tragen. Unser Nachbar ruft den Krankenwagen, ich höre ihn wie aus weiter Ferne sagen: Nein, die Mutter ist ganz ruhig. Vielleicht hätte ich doch Schauspielerin werden sollen. Die Nachbarskinder schwärmen aus, um Friedolin zu benachrichtigen. Er soll eine Tasche packen, so wie der Arm aussieht, werden wir um eine Operation und eine Nacht im Krankenhaus nicht drum rum kommen. Ich halte dem Fünfjährigen Stirn und Hinterkopf und singe leise, um ihn und mich abzulenken, bis der Krankenwagen eintrifft.
Eigentlich hatten die Kinder und ich nur eine kleine Abendrunde durchs Dorf machen wollen, um uns bei den Nachbarn zurück zu melden. Und dann hatten sie so schön gespielt und ich hatte mich verquatscht und eigentlich war längst Abendbrotzeit und ich wollte schon dreimal aufstehen und sagen: „Jetzt müssen wir aber mal“ und dann sprang der Fünfjährige an der höchsten Stelle von der Seilbahn der Nachbarn ab und ich hörte unseren Nachbarsjungen noch rufen: „Nein, da noch nicht!“ und schon war es passiert. Hätte ich doch bloß…, warum konnten wir nicht…, wäre ich doch nur… Unsere Nachbarin sieht meinen flackernden Blick und sagt: „Mach dir jetzt bloß keine Vorwürfe.“ Zum Glück ist eine sehr kompetente Notärztin kurze Zeit später vor Ort, die dem Fünfjährigen direkt einen Zugang legt und ein Beruhigungsmittel verabreicht: „Für die Proseccolaune.“ Im schaukelnden, überhitzten Krankenwagen versuche ich unter meiner Atemschutzmaske Luft zu bekommen, während die Ärztin der Sanitäterin die anstehende Operation im Detail erklärt.
„Können sie vielleicht das Thema wechseln“, bringe ich noch raus, mir wird langsam schwarz vor Augen. Äußerlich bin ich vielleicht ruhig, ich möchte aber trotzdem nicht so genau hören, wie mein Sohn aufgeschnitten wird. „Nehmen sie die Maske ruhig kurz mal ab“, sagt der andere Sanitäter und ich atme erleichtert durch. Gerade hätte ich auch gern etwas für die Proseccolaune.
„Machen sie sich keine Gedanken, Kinder, die toben, verletzen sich. Das gehört dazu.“
Der Fünfjährige und ich machen das gut. Notaufnahme, Röntgen, OP-Besprechung, „Nein, ich lasse ihn nur über Nacht hier, wenn ich auch bleiben kann, er ist Fünf, es ist mir egal, dass Corona ist“, dann warten wir vor dem OP auf die Anästhesistin.
„Dein Opa nennt die Anästhesisten Sandmänner, weil sie schöne Träume bringen“, sage ich zu ihm. Er liegt blass und ruhig auf dem Krankenhausbett, schaut mich tapfer an und sagt:
„Vielleicht gibt es ja auf der einen Hälfte des Planeten Sandmänner, die schöne Träume bringen, und auf der anderen Hälfte Sandfrauen.“ Er sieht winzig aus in dem großen Saal.
„Eigentlich bin ich die Schlafwagenschaffnerin“, sagt die Anästhesistin mit einem Lächeln in der Stimme. Sie erklärt dem Fünfjährigen liebevoll, dass er gleich Herztonmusik hören und sie ihn in das Land der Träume begleiten wird. Er nickt. Dann sagt sie: „Es geht gleich los“ und ist verschwunden. Aber es geht nicht gleich los. Wir warten und warten und warten, ich erzähle und singe und streichele seine Stirn und langsam wird er nervös und zittrig, das Licht ist grell, die Luft schmeckt unangenehm nach Desinfektionsmittel, da kommen plötzlich drei maskierte Frauen im Stechschritt um die Ecke und rollen seine Liege weg. Ich laufe neben her: „Wo ist denn die Anästhesistin?“
„Die kommt gleich.“ Sie fragen nicht, wie er heißt, sie schieben ihn von mir fort. Er beginnt, leise zu wimmern. „Ich geh nur kurz aufs Klo“, sage ich schnell. „Ich komme gleich hinter her.“ Aber er hört, dass es eine Lüge ist und als sie ihn durch eine Schiebetür schieben, beginnt er vor Angst zu schreien. Ich bleibe zitternd zurück und hoffe, dass es wie bei der Eingewöhnung im Kindergarten ist, dass er zu weinen aufhört, sobald ich nur lange genug außer Sichtweite bin. Aber er hört nicht auf, stattdessen wird das Schreien immer panischer. Nach einer gefühlten Ewigkeit kommt die Anästhesistin und will noch letzte Details mit mir klären. „Können sie bitte einfach zu ihm gehen“, flehe ich und spüre wie mir die Stimme weg bleibt. „Er hat so große Angst, sie hat er wenigstens schonmal gesehen.“ Als die Anästhesistin im OP verschwindet, kauere ich mich neben dem Fahrstuhl zusammen und hoffe, dass er nach der OP alles vergessen haben wird.